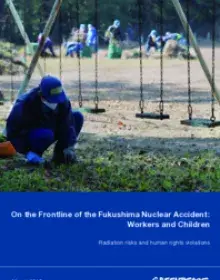Aufstand der Frauen in Fukushima
- Nachricht
In Genf und Tokyo kämpfen zwei Frauen für besseren Schutz vor den Auswirkungen der Atomkatastrophe in Fukushima. Mit Etappensieg: Japan akzeptiert jetzt die UN-Auflagen.
Sie sind fast zehntausend Kilometer voneinander entfernt und kämpfen doch – gemeinsam mit Greenpeace – für dieselbe Sache: einen respekt- und verantwortungsvolleren Umgang mit den Auswirkungen der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima am 11. März 2011. Die Eine, Akiko Morimatsu, steht dafür heute in Genf vor dem Menschenrechtsgerichtshof der UN und berichtet den Delegierten von ihren Erfahrungen, die andere, Mizue Kanno, klagt vor dem Hohen Gericht in Tokyo.
Die Kernforderungen der Frauen sind: Kein Mensch darf einer radioaktiven Strahlung ausgesetzt werden, die die natürliche Hintergrundstrahlung der Umgebung pro Jahr um mehr als einen Millisievert übersteigt. Das entspricht laut japanischen Berechnungen einer Stundendosis von 0,23 Mikrosievert. Und: Niemand, der nicht in die verstrahlten Gebiete rund um das havarierte AKW Fukushima Daiichi zurückkehren möchte, soll dafür finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen.
Nach jahrelanger Arbeit war es Greenpeace vergangenes Jahr gelungen, den menschengefährdenden und ignoranten Umgang Japans mit der Strahlengefahr in der Menschenrechtskommission der UN (UNHRC) in Genf zu thematisieren. Daraufhin stellten etliche UN-Mitgliedsländer, unter anderem Deutschland, Forderungen an Japan, um die Bevölkerung besser vor den gefährlichen Strahlen zu schützen – vor allem Frauen und Kinder. Und heute, bei der offiziellen jährlichen UNHCR-Sitzung in Genf, erklärte Japan, sämtliche dieser Forderungen anzunehmen und umzusetzen.
Mit zwei Kindern auf der Flucht
Akiko Morimatsu und ihre beiden damals drei Monate und drei Jahre alten Kinder wurden nach der Explosion in Fukushima aus Koriyama evakuiert. Der Ort liegt 58 Kilometer vom Atomreaktor entfernt. Vor den Delegierten in Genf redet sie von dieser schwierigen Zeit – und davon, dass sie nicht dazu gezwungen werden will, aus finanziellen Gründen mit ihren Kindern in ihr verstrahltes Dorf zurückkehren zu müssen. „Ich hoffe sehr, dass sich die Politik meines Landes, die Diskriminierung der Fukushima-Opfer in meiner Heimat jetzt mit der Annahme der UN-Auflagen ändert, und dass das heute nicht nur leere Worte waren“, sagt Morimatsu.
Chaos in Namie
In Tokyo kämpft Mizue Kanno vor dem obersten Gericht. Sie lebte vor dem Atomunfall in Shimo-Tsushima, einem kleinen Dorf nahe der Stadt Namie 32 Kilometer westlich von Fukushima. Zusammen mit anderen evakuierten Frauen klagt sie gegen die japanische Regierung und die Fukushima-Betreiberfirma TEPCO wegen fahrlässiger Gefährdung durch radioaktive Strahlen.
„Nach dem Atomunfall herrschte bei uns in Namie Chaos“, erzählt sie. „Wir waren 32 Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt und dachten lange Zeit, wir wären sicher. Die Straßen waren voll mit Menschen, die aus unmittelbarer Nähe des AKWs zu uns geflohen waren. Mehrere evakuierte Familien wurden in unserem Haus untergebracht. Am 15. März, fünf Tage nach der ersten Explosion im Atomkraftwerk und über 24 Stunden nach der dritten, kamen plötzlich Männer in Schutzanzügen und Atemmasken und sagten, die radioaktive Wolke sei längst über unser Dorf hinweggezogen, und wir müssten so schnell wie möglich unser Haus verlassen.“
Das Ende der Duldsamkeit
Ob das wirklich passiert, bleibt abzuwarten. Denn seit sieben Jahren versucht die japanische Regierung, die Atomkatastrophe in Fukushima herunterzuspielen und zu verharmlosen. Versucht, den Anschein zu erwecken, als könnte man in der Region wieder ein normales Leben führen, als hätte man die Auswirkungen des Super-GAUs im Griff. Bei den Gerichtsanhörungen geht es um Japans künftige Atompolitik. Denn bis heute sind nur drei der offiziell 42 Atomreaktoren des Landes wieder am Netz – zu stark ist der Widerstand der Bevölkerung gegen ein Wiederanfahren weiterer Reaktoren.
Gerade Frauen wie Akiko Morimatso und Mazue Kanno sind die Speerspitze dieses Widerstandes gegen die Atomkraft. Überall im Land haben sich Mütter erhoben, ihre gerichtlichen Klagen kann der Staat nicht ignorieren. Und das ist für das Land der aufgehenden Sonne absolut ungewöhnlich: Denn Rebellion, Aufmüpfigkeit und Widerspenstigkeit gelten in Japan nicht als Tugenden – und bei Frauen schon gar nicht.
Manchmal wundert sich Mizue Kanno selber über ihre Courage. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal meine Regierung, mein Land, verklagen würde.“ Aber der Atomunfall in Fukushima hat alles verändert. Ihr Leben, ihr Sicherheitsgefühl – und auch ihre Duldsamkeit.
Fahrlässiger Umgang mit der Strahlengefahr
Es sind vor allem diese fünf Tage Unsicherheit und Chaos, die Mizue Kanno der Regierung und TEPCO nicht verzeiht. Sie kann nicht verstehen, warum sie und ihre Familie nicht gleich evakuiert wurden, warum man versuchte, die Auswirkungen des Unfalls herunterzuspielen. Warum Messergebnisse zurückgehalten und die Menschen nicht ausreichend informiert wurden. Bis heute weiß sie nicht, welcher vermeidbaren Strahlendosis sie dadurch ausgesetzt war. Ihr Vertrauen in den staatlichen Umgang mit der Gefahr ist dahin. Auf gar keinen Fall will sie in ihre verstrahlte Heimat zurückkehren müssen. Auch dagegen prozessiert sie.
Im September vergangenen Jahres besuchte Mizue Kanno zum ersten Mal nach sieben Jahren für drei Stunden ihr verlassenes Haus: Zusammen mit einem Expertenteam von Greenpeace, das die Strahlenbelastung des Hauses maß. Denn sie wollte ehrliche Ergebnisse haben. Die Messungen zeigen: Eine unbedenkliche Rückkehr ist nicht möglich. Trotz intensiver Dekontaminierungsarbeiten lagen die Strahlenwerte zwischen 1,3 und 5,8 Mikrosievert pro Stunde – also um das fünf bis 20-fache über dem angestrebten Grenzwert. Dabei hatten die japanischen Behörden Mizue Kannos Haus besonders intensiv säubern lassen, da es deren Vorzeigeprojekt für alle Rückkehrer ist.
Überall strahlende Hotspots
Die Greenpeace-Messungen zeigen auch: Das Heimtückische an der Radioaktivität ist, dass sich zwar einzelne Häuser und Straßen für eine Weile von Radioaktivität säubern lassen, aber eben nicht die ganze Region. Und dass die permanente Gefahr besteht, dass hochstrahlende Cäsiumpartikel etwa aus den Bergwäldern ringsum wieder in Wohnzimmer wehen.
Durch Zufall hat das Greenpeace-Team einen auf diese Art kontaminierten Hotspot entdeckt: An der Straße 114, vor dem Haus einer Freundin von Mizue Kanno. 137 Mikrosievert pro Stunde zeigten die Messgeräte an. Die beiden Straßenarbeiter, die dort ohne Schutzkleidung und Atemmasken aufräumten, wussten nichts von der Gefahr.
Der Plan der japanischen Regierung, die verstrahlen Gebiete in Teilen zu dekontaminieren und die Bevölkerung zur Rückkehr zu drängen, ist Wahnsinn, das haben die jährlichen Messreports von Greenpeace wieder und wieder bestätigt. Dennoch hat Japan im vergangenen Jahr Dörfer wie Iitate zur Wiederbesiedlung freigegeben. Demnächst soll Namie folgen und somit auch das Haus von Mizue Kanno, so der bisherige Plan der Regierung. Nach dem, was die japanische Delegation heute allerdings in Genf versprochen hat, müssten diese Pläne gestoppt werden.
Video "Frau Kanno besucht ihr Haus in Fukushima" (Untertitel in deutsch oder englisch anwählen):
Zum Weiterlesen: