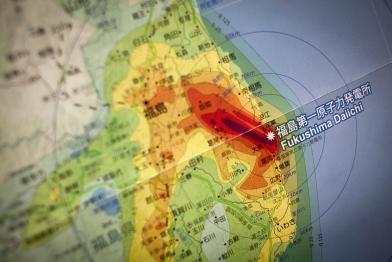Asse II - der Endlager-GAU
- Hintergrund
Tausende von Jahren sollte das „Versuchsendlager“ im ehemaligen Salzbergwerk Asse II sicher sein – so versprachen es Betreiber, Aufsichtsbehörden und Gutachter:innen. Knapp vier Jahrzehnte später säuft es durch Wassereinbrüche ab, die Schachtanlage droht einzustürzen. Aktuell fließt sogar mehr Wasser ins Bergwerk, als Expert:innen befürchtet haben - die Asse droht vollzulaufen, die Bergung zu gefährden und somit die Umwelt radioaktiv zu belasten. Eine Bergung der rund 126.000 eingelagerten Fässer und Gebinde mit schwach und mittel radioaktiven Abfällen ist nach wie vor möglich, sollte aber unbedingt beschleunigt werden. Der Prozess wird Steuerzahler:innen voraussichtlich vier bis sechs Milliarden Euro kosten. Dabei stammt der überwiegende Teil des Atommülls aus deutschen Atomkraftwerken.

Die aktuelle Situation um Asse II ist bedrohlich und zeigt vor allem, wie sich ursprüngliche behördliche Einschätzungen als falsch erwiesen haben. Nun entsteht ein unvorhersehbarer Schaden, der sich nicht rückgängig machen lässt, mit langfristigen Folgen für Natur, Umwelt und uns Menschen.
Der Großversuch im Salzbergwerk Asse II bei Wolfenbüttel galt lange als Blaupause für das ebenfalls in Niedersachsen geplante Endlager für die noch gefährlicheren, hoch radioaktiven Abfälle im Salzstock Gorleben. Doch davon wollte nach Bekanntwerden des Desasters in der Asse II keiner der verantwortlichen Politiker:innen, Ministerialbürokrat:innen und Expert:innen mehr etwas wissen. Denn ein genauer Blick auf die Vorgänge in dem Salzstock – und auf das nur wenige Kilometer entfernte, einsturzgefährdete ostdeutsche Endlager in Morsleben – ließ nur einen Schluss zu: Gorleben durfte niemals zum Atommüllendlager werden. An allen drei Standorten warnte die Wissenschaft frühzeitig vor den Risiken der Einlagerung im Salz. An allen drei Standorten wurde sie mundtot gemacht oder übergangen. In Gorleben konnte der absehbare Endlager-GAU noch gestoppt werden, der Standort steht nicht mehr zur Debatte.
Aus den Augen, aus dem Sinn mit dem Atommüll
Von 1909 bis 1964 dient der Schacht Asse II bei Wolfenbüttel dem Abbau von Kali- und Steinsalz. Die Nachbarschächte Asse I und III werden schon 1906 und 1924 aufgegeben – sie sind seit Jahrzehnten abgesoffen – also mit Wasser vollgelaufen. Umso intensiver geht der Abbau in Schacht II weiter. Der Salzstock ist am Ende durch den Bergbau durchlöchert wie ein Schweizer Käse – mit entsprechenden Folgen für Stabilität und Wasserdichtheit.
1965 erwirbt die Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF) im Auftrag des Bundes das Salzbergwerk für 750.000 DM und gründet das „Institut für Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle“. Die Asse wird „Versuchsendlager“. Weil die Bundesrepublik den Einstieg in die kommerzielle Nutzung der Atomenergie plant und Platz für den anfallenden Atommüll braucht. Und weil der Besitzer die unrentable Kaligrube verkaufen will.
Von 1967 bis 1971 werden die angelieferten Fässer mit schwach radioaktiven Abfällen in der Tiefe noch mit Gabelstaplern senkrecht stehend übereinander getürmt, bis 1974 dann auch in zehn Lagen übereinander liegend. Von 1973 bis 1978 kommen in Zementmörtelhüllen eingebettete 200-Liter-Fässer hinzu. Ab 1974 werden die Fässer per Radlader vom Kammerzugang über die Böschung in die Kammer gekippt, um den Zeitaufwand zu beschränken.
Die Einlagerung der Fässer wird schlampig dokumentiert und diese schlampige Dokumentation dann auch noch chaotisch archiviert. Die Lieferscheine sind unvollständig und teilweise handschriftlich ausgefüllt. Unter dem Deckmantel der Forschung wird das Bergwerk wie eine wilde Müllkippe genutzt. Knapp 16.000 Fässer in der Asse II enthalten besonders gefährlichen mittelaktiven Müll. Mindestens neun Kilogramm Plutonium wurden über die Jahre in den Salzstock eingebracht. Plutonium ist einer der giftigsten Stoffe überhaupt, schon ein Millionstel Gramm im Körper kann Krebs auslösen. Auch andere hochgefährliche chemotoxische Stoffe, von denen niemand genau weiß, wie sie reagieren, landen im niedersächsischen Salzstock. Die bisher bekannt gewordenen Unterlagen spiegeln durchweg das Ziel der Asse-Nutzung wider: Aus den Augen, aus dem Sinn mit dem gefährlichen Müll.
Die Asse säuft ab
Mit der Novellierung des Atomgesetzes 1976 schreibt der Bund für Endlager ein Planfeststellungsverfahren vor. Doch für die Asse II führt die GSF keines mehr durch. Vielmehr wird die Einlagerung radioaktiver Abfälle mit dem Auslaufen der Verträge am 31.12.1978 beendet. Zuvor wurden in den letzten beiden Betriebsjahren noch rund 50.000 Fässer eilig abgekippt.
1988 stellt die GSF neue Lösungszutritte in der Südwestflanke des Salzstocks fest, fünf Jahre später wird bereits ein Wassereintritt von fünf Kubikmetern pro Tag gemessen. 1994 kann ein vom niedersächsischen Umweltministerium in Auftrag gegebenes Gutachten einen „nicht beherrschbaren Wassereinbruch“ nicht mehr ausschließen. Später muss die Betreibergesellschaft zugeben: Die Asse säuft ab.
Heute fließen Tag für Tag rund 12.000 Liter salzhaltiges Grundwasser ins Bergwerk – das entspricht dem Inhalt von rund 50 Badewannen. Niemand weiß, wie viele der rund 126.000 eingelagerten Fässer und Gebinde inzwischen Leck schlugen. Fest steht: Radioaktive Lauge sickert aus den Atommüllkammern. Langfristig könnte Radioaktivität ins Grundwasser gelangen.
Nur wenn die Fässer zurückgeholt werden, lässt sich verhindern, dass radioaktive Strahlung austritt und das Grundwasser kontaminiert. Deshalb soll der Atommüll aus dem maroden Bergwerk geborgen und erst einmal oberirdisch zwischengelagert werden. Die Kosten dafür werden auf vier bis sechs Milliarden Euro beziffert.
Die Profite für die Unternehmen – die Kosten für Bürger:innen
Über Jahrzehnte diente Asse II als Nachweis für die sichere Entsorgung von Abfällen deutscher Atomkraftwerke. Solche Art Erklärungen finden sich in den Genehmigungen für 17 AKW. Selbst in der Dauerbetriebsgenehmigung für das AKW Grohnde verweisen die Behörden 1985, also sieben Jahre nach der letzten Einlagerung, noch auf die „erprobte Einlagerungstechnologie“ in der Asse.
Es überrascht daher nicht, dass mehr als 85 Prozent der in der Asse eingelagerten radioaktiven Gesamtaktivität aus den Anlagen der heutigen Kernkraftwerksbetreiber E.on, Vattenfall Europe, RWE und EnBW stammt. Die Konzerne profitierten dabei direkt von den niedrigen Sicherheitsstandards für die Einlagerung.
Und sie profitierten auch finanziell. Von 1967 bis 1975 wurden gar keine Gebühren für die Einlagerung radioaktiver Abfälle in die Schachtanlage Asse II erhoben – für rund 50 Prozent der eingelagerten Fässer zahlten die Abfallverursacher nichts. Ab Dezember 1975 galt die Gebührenregelung für die Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen im Salzbergwerk Asse II. Je nach Fass- und Gebindegröße und Dosisleistung mussten, so führt das Bundesministerium für Umwelt auf, zwischen 150 und 3700 DM pro Gebinde gezahlt werden. Insgesamt kamen so 16,5 Millionen DM zusammen. Bei aktuell geschätzten Sanierungskosten von vier bis sechs Milliarden Euro macht dieser Betrag gerade einmal 0,2 Prozent der tatsächlichen Kosten aus.
Auch wenn viele Fragen rund um die Asse noch offen sind, ist für Greenpeace eines ganz klar. Die Atomkonzerne dürfen sich jetzt nicht vor ihrer Verantwortung drücken. Sie müssen als Verursacher die Kosten für die Rückholung übernehmen.