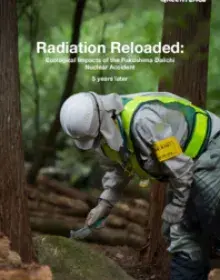Bericht aus Fukushima: Der Geschmack der Angst
- Ein Artikel von Ortrun Sadik
- Nachricht
Seit dem Super-GAU reist Heinz Smital, Greenpeace-Experte für Atomkraft, jährlich für Strahlenmessungen nach Fukushima. Hier erzählt er von seiner Tour im September 2017.
Die Sonne scheint auf den alten Holztempel in Namie. Es ist ein warmer Septembertag, ich würde gerne die Jacke ausziehen. Den Feigenbaum und das warme Holz riechen, den Wind auf meinen Armen spüren. Stattdessen stehe ich hier mit langen Ärmeln, versiegelter Schutzkleidung und Handschuhen, um möglichst viel Haut zu bedecken. Mir ist heiß, meine Atemmaske rutscht, ich schmecke meinen salzigen Schweiß auf den Lippen.
Namie, eine Stadt mit einst 20.000 Einwohnern, ist verlassen. Eine Geisterstadt. Verrostete Schaukeln quietschen leise im warmen Wind, kein Kind spielt heute noch hier. Denn Namie liegt in der Sperrzone von Fukushima, dem Atomkraftwerk, das am 11. März 2011 nach dem Tsunami explodierte. Die Gegend ist hochgradig radioaktiv verstrahlt. Seit dem Atomunfall komme ich mit internationalen Greenpeace-Kolleg:innen jedes Jahr ein- bis zweimal in die Region, um die Strahlenwerte zu messen. Um den offiziellen Zahlen der japanischen Regierung etwas entgegenzusetzten, die einzelne Häuser und Straßenzüge vergeblich von der Strahlung zu reinigen versucht und dennoch die einstigen Anwohner:innen dazu drängt, zurückzukehren.
Allgegenwärtig: die Radioaktivität
Meine Atemmaske drückt und kratzt, doch ich mag sie nicht abnehmen. Das Messgerät in meiner Hand wiegt schwer. Doch unablässig fahre ich mit ihm meine Umgebung ab. Denn überall könnten sie liegen, die Bröckchen konzentrierten Cäsiums. Gelangte solch ein radioaktives Staubkorn in den Körper eines Menschen, weil er es einatmet oder verschluckt, so wäre das fatal. Es könnte sich im Körper einlagern. Die ionisierende Strahlung, die von ihm ausgeht, würde das Erbgut der nahen Zellen schädigen. Und die könnten mutieren und zu Krebszellen werden.
Unsichtbare Gefahr
Radioaktivität ist eine Gefahr, die einen wahnsinnig machen kann. Selbst mich, der ich Atomphysik studiert habe. Obwohl ich genau weiß, wie die Partikel sich verhalten, wo sich die Radioaktivität am wahrscheinlichsten sammelt und warum ich mich wie verhalten muss, um die Belastung für meine Gesundheit so gering wie möglich zu halten. Selbst mich belastet diese unsichtbare, nicht riech- und fühlbare Gefahr. Wie erst muss es den Menschen gehen, die hierher zurück sollen, in diese verstrahlte Stadt?
Besonders bitter finde ich, dass Japans Regierung auch Kinder zur Rückkehr in die belasteten Gebiete drängt. Ich bin mehr als 50 Jahre alt. Mein Körper ist für Strahlung viel weniger empfänglich als der eines Kindes, das mit der Belastung so viele Jahre länger noch leben muss. Außerdem bin ich Strahlenexperte und weiß ganz genau, wie ich mich zu verhalten habe. Aber Kinder? Die müssen doch im Garten spielen. Erde anfassen, Grashalme kauen, über die Wiese tollen. Die haben keine Ausbildung im Strahlenschutz. Die beachten nicht die Regeln zur Kontaminationsvermeidung. Und wie oft haben wir auf Spielplätzen oder in der Nähe von Schulen erhöhte Strahlenwerte gefunden!
Verdrängen als Überlebensstrategie
Für Greenpeace war ich schon an vielen Orten atomarer Katastrophen, nicht nur in Fukushima. Ich war auch in La Hague und Sellafield und natürlich in Majak und Tschernobyl. Doch egal ob in Russland oder in Japan – immer wieder fällt mir eine Art Gespaltenheit auf, mit der manchmal ein einziger Mensch auf die Gefahr der Strahlung reagiert: Im einen Moment ist er sich der Gefahr bewusst und versucht, eine Gefährdung so gut es geht zu vermeiden. Aber dazu muss er sich der Angst aussetzten – und die macht krank.
Der andere Umgang ist schlechter für den Körper, aber leichter für die Psyche: Ignorieren. Verdrängen. Verharmlosen. Vergessen. Und obwohl ich als Wissenschaftler weiß, wie falsch und gefährlich dieser Umgang mit der Strahlung ist, kann ich doch verstehen, dass ein Weiterleben so einfacher ist. Immer wieder bin ich diesem Verdrängen und Verleugnen begegnet.
In Tschernobyl aßen sie Pilze
In Tschernobyl aßen die Arbeitenden Pilze aus der Region – und gegen die Radioaktivität tranken sie Wodka. In Fukushima steht alle paarhundert Meter eine Messstation und zeigt die aktuelle Radioaktivität an. Das beruhigt – so hoch ist der Wert ja gar nicht. Und betrügt uns doch. Denn was sagt das Messergebnis aus? In unmittelbarer Umgebung des Gerätes ist die Strahlung gering. Doch was ist gleich daneben? Oft haben wir nicht weit entfernt von Messstationen strahlende Hotspots gefunden.
Ich mache eine Pause vom Messen und betrachte den alten Holztempel, nehme für einen Moment die klebende Atemmaske ab, so dass der Wind mir über das Gesicht wehen kann – das tut gut. Ich schaue auf die verrosteten Schaukeln, auf denen seit sieben Jahren keine Kinder mehr spielen. Diese Leere ist beklemmend.
Die Zerstörung geht – die Radioaktivität bleibt
Vor ein paar Tagen war ich in einem nahegelegenen Gebiet, das zwar schwer von der Tsunami-Flutwelle 2011 getroffen worden war, aber von der radioaktiven Wolke nach dem Super-GAU verschont geblieben ist. Immer wieder flattern dort Stoffbänder an Sträuchern oder Schilfrohren. Sie erinnern an die Toten, die an diesen Stellen gefunden wurden, erzählte mir meine Begleitung.
Doch so heftig die Zerstörung war: Heute geht das Leben dort weiter. Die Häuser wurden wiedererrichtet, die Gärten neu bepflanzt. Es wächst Gemüse und Hirse, Kinder spielen auf den Straßen. Namie hingegen ist zerstört und wird es noch lange bleiben. Denn die Radioaktivität strahlt dort noch Jahrzehnte weiter.
Schluss mit Atomkraft
Ich setze meine Atemmaske wieder auf und frage mich, ob ich in dieser kurzen Pause gefährliche Partikel eingeatmet habe. Wie machen das die Arbeiter:innen, die hier die Gegend dekontaminieren sollen? Bleiben sie immer in ihrer Schutzkleidung? Und wie um alles in der Welt machen das die Menschen, die wieder in die freigegebenen aber weiterhin verstrahlten Gebiete zurückgekehrt sind?
Ich will, dass dieser Irrsinn aufhört. Atomkraft ist zu zerstörerisch, zu gefährlich. Die Kraft der Kettenreaktion – sie ist zu groß für uns. Ich wünschte, die Menschheit wäre demütiger. Und ich wünsche mir das Ende der Atomkraft. Das merke ich ganz besonders an einem Ort wie diesem, der nach der Katastrophe keine Chance hat, zu einer neuen Normalität zurückzukehren. Hier, an diesem Tempel, an dem ich das Gefühl habe, Radioaktivität schmecken zu können. Für mich schmeckt sie nach Salz und Schweiß. Nach Bitterkeit und Angst.
Das Video zeigt die Arbeit von Heinz Smital Anfang 2017 in Iitate, rund 40 Kilometer nordwestlich von Fukushima.
Zum Weiterlesen: