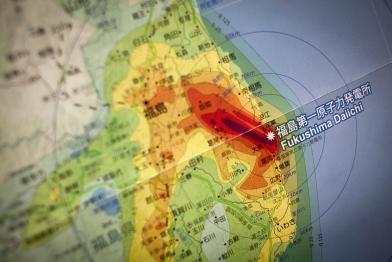Zum Endlager erkoren
Ein maroder Salzstock ist seit Ende der siebziger Jahre als Endlageroption für hoch radioaktiven Müll ausersehen. Das sogenannte Erkundungsbergwerk im niedersächsischen Gorleben musste als Entsorgungsnachweis für die bundesdeutschen Atomkraftwerke herhalten, obwohl dort kein einziges Gramm Atommüll eingelagert wurde und die Eignung des Salzstocks unter Fachleuten sehr umstritten ist.
- Hintergrund
Am 22. Februar 1977 benennt der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) das Elbdorf Gorleben zum Standort für ein Nukleares Entsorgungszentrum (NEZ). Die Planungen umfassen ein Zwischenlager für schwach und mittel radioaktive Abfälle, ein Transportbehälterlager für Castorbehälter mit hoch radioaktiven Abfällen und ein Endlager im Salzstock Gorleben-Rambow.
Die ebenfalls geplante Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) erklärt Albrecht 1979 für wirtschaftlich machbar, aber politisch nicht durchsetzbar. Eine Anlage zur endlagerfähigen Bearbeitung (Konditionierung) der Abfälle wird 1986 in die Planungen aufgenommen und ist seit 1998 betriebsbereit. Kernstück des NEZ ist das geplante Endlager im Salzstock. Ohne die Deponie ergibt der Betrieb der anderen Atomanlagen an dieser Stelle keinen Sinn. Kleiner Schönheitsfehler: Bis zur Standortbenennung lagen keine Untersuchungen darüber vor, ob sich der Gorlebener Salzstock überhaupt dafür eignet, radioaktive Abfälle für mindestens eine Million Jahre von der Biosphäre zu isolieren.
Update am 29.11.2024: Rückbau hat begonnen
Am 29. November 2024 hat der offizielle Rückbau des Erkundungsbergwerks Gorleben begonnen. Der Salzstock wird mit den ersten Ladungen Salz zugeschüttet. Insgesamt 400.000 Kubikmeter Salz sollen in den kommenden drei Jahren in die Hohlräume verfüllt werden. Dies ist ein wichtiges Signal, um Vertrauen in die sichere Endlagersuche zurückzubringen. Jahrzehntelang wurde der Salzstock in Gorleben als einzig mögliches Atommüll-Endlager diskutiert, obwohl wissenschaftliche Untersuchungen ihn als geologisch ungeeignet und somit als unrealistische Option eingestuft haben.
Der Gorlebener Salzstock
Der Gorlebener Salzstock ist etwa 14 Kilometer lang und bis zu 4 Kilometer breit. Er reicht aus ungefähr 3,5 Kilometern Tiefe bis etwa 260 Meter unter die Erdoberfläche. Die Aufwärtsbewegung der vor 250 Millionen Jahren entstandenen Salzmassen, verursacht durch den Druck der darüber lagernden jüngeren Gesteinsschichten, dauerte bis ins Quartär. Diese jüngste Periode der Erdneuzeit begann vor circa 1,6 Millionen Jahren. Sogar heute geht der Aufstieg des Salzes weiter, allerdings nach menschlichen Begriffen unvorstellbar langsam.
Das sogenannte Erkundungsbergwerk umfasst zwei Schächte von 840 und 940 Metern Tiefe. Sie sind in 840 Metern Tiefe durch einen horizontalen Stollen miteinander verbunden. Zusätzlich sind im Erkundungsbereich weitere Stollen aufgefahren worden. Die bisherige Erkundung fand im nordöstlichen Teil des Salzstocks statt.
Der Arbeitskreis Endlager
Der vom damaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) 1999 beauftragte Arbeitskreis Endlager (AkEnd) entwickelte 40 Jahre nach Beginn der Atommüllproduktion erstmals umfangreiche wissenschaftliche Kriterien für die Endlagerstandortsuche. Ob es aber jemals zu einer vergleichenden Standortsuche in mehreren Regionen kommen würde, blieb ungewiss. Die Energieversorger hatten damals bereits knapp 1,3 Milliarden Euro in Gorleben versenkt und wollen deshalb getreu ihrem Grundprinzip „Wirtschaftlichkeit vor Sicherheit“ an Gorleben festhalten.
Das Endlagersuchgesetz
Seit dem 1.1.2014 ist das neue Endlagersuchgesetz (Standortauswahlgesetz - StandAG) in Deutschland in Kraft. Das Gesetz sieht vor, die Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll neu zu regeln. Eine 33-köpfige Kommission soll zunächst bis 2015 Kriterien für einen möglichen Standort erarbeiten und dem Bundestag vorschlagen.
Obwohl eine ergebnisoffene Suche angekündigt wurde, ist - noch bevor die Kommission ihre Arbeit aufnehmen konnte - bereits ein detailliertes Gesetz im breiten Parteienkonsens aber ohne ausreichend Beteiligung der Bürger verabschiedet worden. Auch wird bereits parallel zur Kommissionsarbeit eine Behörde (das Bundesamt für Kerntechnische Entsorgung) mit denselben Arbeitsschwerpunkten wie die Kommission die Arbeit aufnehmen. Der Standort Gorleben bleibt (wie zuvor erwartet) im Verfahren.
Greenpeace kritisiert das Gesetz in seiner jetzigen Form sowie die Reihenfolge des Suchprozesses. Im Herbst 2012 hat Greenpeace bereits einen eigenen Vorschlag für die ergebnisoffene Endlagersuche vorgelegt.
Der Standort Gorleben
Die Atommüllproblematik ist ein gesellschaftliches Thema, für das es keine einfachen Antworten gibt. Gleichwohl ist unsere Generation verpflichtet, die ersten Schritte hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem gefährlichen Atommüll zu finden. Nach über 35 Jahren verfehlter Atommüllpolitik ist hierfür eine nationale Endlagerdebatte notwendig.
Bei einem echten Neuanfang in der Endlagersuche darf der Standort Gorleben nicht aufgenommen werden, denn dieser wurde in den siebziger Jahren politisch – nicht aufgrund eines wissenschaftlichen Auswahlverfahrens - willkürlich ausgewählt. Die Anwendung der von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) formulierten Mindestkriterien für einen möglichen Endlagerstandort in Salz stuft den Standort Gorleben nicht einmal als untersuchungswürdig ein. Der Salzstock ist durchzogen von Laugen- und Gasvorkommen, zudem liegen Grundwasser führende Schichten direkt auf dem Salzstock und es fehlt ein abschließendes Deckgebirge.
Das in über 35 Jahren gesammelte Wissen um den Standort Gorleben, einschließlich seiner Mängel, wird das gesamte Suchverfahren von Anfang an negativ beeinflussen. Die Aufstellung jedes Kriteriums wird immer auch zugleich eine Entscheidung über die Eignung oder Nichteignung des Standortes Gorleben sein. Eine ergebnisoffene, sicherheitsorientierte Debatte ist mit Gorleben im Verfahren nicht möglich.
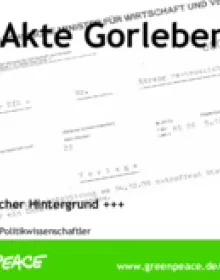
Die Akte Gorleben
Anzahl Seiten: 50
Dateigröße: 10.59 MB
Herunterladen