
Greenpeace-Recherche: Goldrausch vergiftet den Amazonas-Regenwald
- Ein Artikel von Miryam Nadkarni
- Nachricht
Nach wochenlanger Recherche schlägt Greenpeace Alarm: Illegale Goldgräber:innen haben in nur zwei Jahren über 4.000 Hektar Regenwald in indigenen Gebieten vernichtet.
Der antike König Midas wünschte sich, dass alles, was er berührte, zu Gold würde. Ein Geschenk, das sich schnell als Fluch entpuppte: Er konnte seinen Hunger nicht stillen und seine Tochter nicht umarmen, ohne dass sie zu kaltem Metall erstarrte. Heute spiegelt sich die Warnung dieser alten Sage in einer realen Tragödie wider: Im Amazonasgebiet zerstört der globale Hunger nach Gold riesige Flächen des Regenwalds. Und das beim Abbau eingesetzte Quecksilber vergiftet die dort lebenden Indigenen und Tiere.
Damit gefährden wir nicht nur ein Naturparadies und die Menschen, die im und um den Regenwald leben, sondern auch unsere eigene Lebensgrundlage. Denn der Amazonas-Regenwald stabilisiert das globale Klima – und mit jedem abgeholzten Baum verlieren wir einen Verbündeten im Einsatz gegen die Klimakrise. Wie der Sagenkönig Midas sind wir dabei, unsere eigene Lebensgrundlage für Gold zu opfern.
Illegale Goldminen verlagern sich, statt zurückzugehen
Eine neue Recherche von Greenpeace, die Satellitendaten aus den Jahren 2023 und 2024 analysiert, zeigt alarmierende Entwicklungen im Amazonasgebiet: Die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung des illegalen Goldabbaus haben nicht zu einem generellen Rückgang der Aktivitäten geführt – vielmehr haben sie sich in andere indigenen Gebiete verschoben. Besonders drastisch ist die Situation im Sararé-Gebiet, wo der illegale Bergbau um ganze 93 % zugenommen hat. Gleichzeitig gingen die Aktivitäten in anderen Regionen wie dem Yanomami-Gebiet (-7 %), dem Munduruku-Land (-57 %) und dem Kayapó-Land (-31 %) zurück.
Die Rechercheergebnisse machen deutlich, wie stark der Druck auf indigene Gebiete weiterhin ist – eine direkte Folge der früheren brasilianischen Regierung unter Präsident Bolsonaro, die illegale Goldminen jahrelang gewähren ließ. Zwischen 2018 und 2022 explodierte der illegale Bergbau regelrecht: Die Abbauflächen auf indigenem Land wuchsen um unglaubliche 265 %. Die Folgen? Zerstörte Wälder, verseuchte Flüsse und massive Eingriffe in die Lebensgrundlage indigener Gemeinschaften.
Seit 2023 geht die neue Regierung unter Präsident Lula härter gegen illegale Minen vor – mit verstärkten Kontrollen und gezielten Polizeiaktionen. Doch obwohl diese Maßnahmen sichtbarer sind, gelingt es bisher nicht, die Ausbreitung des Bergbaus grundsätzlich zu stoppen. Stattdessen passen sich die Minenbetreiber an, weichen auf andere Gebiete aus und treiben die Zerstörung voran. Zu lukrativ ist das Geschäft, zu arm die Goldgräber:innen.
Das zeigt: Ohne langfristige, konsequente Strategien wird sich der illegale Goldabbau nicht eindämmen lassen.
Giftgold aus dem Amazonas

Wie illegales Amazonas-Gold in die Weltmärkte gelangt
Noch nie war Goldabbau so lukrativ wie heute. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und globaler Krisen steigt die Nachfrage nach dem Edelmetall weiter – allein 2024 ist der Goldpreis um 44 % gestiegen. Zentralbanken und Investor:innen treiben den Markt an, während illegales Gold aus dem Amazonasgebiet unbemerkt in den weltweiten Handel gelangt.
Gold ist extrem schwer nachzuverfolgen. Sein hoher Wert, die dadurch mögliche kompakte Größe von Goldbarren und die nahezu unbegrenzte Haltbarkeit machen es zum idealen Schmuggelgut. Einmal in den Lieferketten, verliert sich seine Spur: Es wird gehandelt, raffiniert, weiterverarbeitet – und gelangt schließlich in den legalen Markt.
Schweizer Gold: vertrauenswürdig – oder nur gut getarnt?
Im Jahr 2024 gingen die meisten brasilianischen Goldexporte nach Kanada (29,4 Tonnen), in die Schweiz (16 Tonnen) und ins Vereinigte Königreich (7,5 Tonnen) – drei der wichtigsten Drehscheiben für den internationalen Goldhandel. Besonders die Schweiz spielt eine zentrale Rolle: Sie ist nicht nur der größte globale Handelsplatz für Gold, sondern auch das Tor für über die Hälfte der EU-Goldimporte – auch für Deutschland. Die Schweiz ist einer der wichtigsten Knotenpunkte für den Goldhandel und die Raffinierung – dabei besitzt das Land nicht einmal eigene Vorkommen. Doch wie wurde die Schweiz zu einem globalen Schwergewicht im Goldgeschäft?
Die Geschichte ist belastet: Während des Zweiten Weltkriegs kauften Schweizer Banken mehr als drei Viertel des Nazigoldes – darunter große Mengen an Raubgold. Auch nach dem Krieg handelten sie mit sanktionierten Regimen, etwa dem Apartheidsregime in Südafrika, und halfen ihnen, an Devisen zu kommen. Der Vorwand? Schweizer Neutralität. Trotz internationaler Kritik hielt das Land an diesen Geschäften fest.
Die Rolle der Schweizer Goldraffinerien – ein verschleierter Ursprung des Goldes
Heute befinden sich vier der sieben größten Goldraffinerien der Welt in der Schweiz und dominieren den globalen Markt. Sie kaufen Roh- oder Recyclinggold auf, raffinieren es teilweise nochmals und verarbeiten es weiter oder exportieren es. Einmal in der Schweiz angekommen, wird Gold umetikettiert und unter dem begehrten Label „Swiss Gold“ weiterverkauft. Seine ursprüngliche Herkunft? Oft kaum noch nachvollziehbar.
2024 importierte die Schweiz mehr als 2000 Tonnen Gold. Besonders auffällig: Laut Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit stammten 155,8 Tonnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) – offiziell als „recyceltes Gold“ deklariert. Doch die VAE haben, genau wie die Schweiz, keine eigenen Goldvorkommen. Dubai hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der weltweit größten Umschlagplätze für Gold entwickelt, insbesondere auch für Gold aus Krisengebieten in Afrika, aber lasche Vorschriften und mangelnde Kontrollen machen es schwer, die tatsächliche Herkunft des Goldes zu überprüfen.
Von Dubai aus gelangt das Gold als „recyceltes Gold“ in die Schweiz, wo es weiterverarbeitet und als hochwertiges „Swiss Gold“ in den internationalen Handel eingespeist wird. Das sorgt für Vertrauen – aber verschleiert oft, woher das Gold ursprünglich stammt.
Die Greenpeace-Recherche „Giftgold“ deckt dabei brisante Ungereimtheiten auf: 2022 überstiegen die Goldimporte der Schweiz die offiziell aus Brasilien gemeldeten Exporte um 67 %, 2023 lag die Differenz immer noch bei 62 %. Diese Lücken im Handel deuten darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil des Goldes auf intransparente oder illegale Weise in den internationalen Markt gelangt.
Deutschland und das schmutzige Geschäft mit Amazonas-Gold
Zwischen 2019 und 2023 importierte Deutschland laut Destatis 720 Tonnen Gold – 56 % davon über die Schweiz, die als zentrales Drehkreuz für den europäischen Goldhandel gilt. Direkt aus dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas kamen 1289 kg. Diese stammen nach einer Auswertung des brasilianischen Instituto Escolhas mit hoher Wahrscheinlichkeit aus illegalem Abbau. Doch das bedeutet nicht, dass dies das einzige illegale Amazonas-Gold ist, das in Deutschland landet. Die verschlungenen Handelswege und mangelnde Transparenz begünstigen es, dass fragwürdiges Gold unbemerkt in eigentlich seriösen Märkten auftaucht. Solange das nicht besser nachverfolgt wird, bleibt das Risiko hoch, dass auch Deutschland unwissentlich von Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen im Amazonasgebiet profitiert.
Gefahren des illegalen Goldabbaus
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland RND geht davon aus, dass im Amazonas-Regenwald derzeit über 20.000 illegale Goldgräber:innen aktiv sind. Die genaue Zahl lässt sich nicht bestimmen, vermutlich sind es viel mehr. Sie schlagen ihre Camps unter dem dichten Dach des Regenwaldes auf und suchen sich unberührte Stellen, um nach Gold zu graben. Dabei holzen sie oft großflächig Bäume ab, graben und fluten tiefe Erdlöcher. Nicht selten kommt es dabei auch zu Gewalttaten oder tödlichen Übergriffen gegenüber Indigenen. Besonders problematisch: Die Goldförderung verwendet große Mengen an hochgiftigen Quecksilber, um das Gold aus dem Gestein zu lösen. Das Schwermetall gelangt beim Goldabbau in das Grundwasser und vergiftet umliegende Flüsse und Seen. Quecksilber ist nicht biologisch abbaubar, reichert sich in der Nahrungskette an und verursacht bei Menschen und Tieren irreversible Schädigungen des Nervensystems.
So lässt sich der illegale Goldabbau stoppen
Was braucht es also, um den illegalen Goldabbau im Amazonasgebiet zu stoppen? “Geld”, sagt Brasiliens Präsident Lula. “Starke Landrechte für Indigene”, sagt Jorge Eduardo Dantas, Kampagnenleiter für Indigenenrechte von Greenpeace Brasilien. “Eine Strategie, um die Goldminen systematisch zu bekämpfen”, sagt Harald Gross, Amazonas-Experte von Greenpeace Deutschland. So müssten die Polizei und Sicherheitsbehörden besser aufgestellt werden, um die Goldgräber:innen dauerhaft fernzuhalten. Die finanzielle Unterstützung ist wichtig, um die lokalen Gemeinden so zu versorgen, dass die Armut sie nicht mehr in die Minen treibt, in denen sie sich selbst und ihr Umfeld vergiften.
Doch woher soll dieses Geld kommen? Auf der Klimakonferenz COP 30, die dieses Jahr im November in Brasilien stattfindet, werden die UN-Mitgliedstaaten auch darüber diskutieren, wie wir den Klima- und Naturschutz und den Schutz von Ökosystemen, wie dem Amazonas-Regenwald, finanzieren können. Konkret geht es um den sogenannten Tropical Forest Finance Facility, kurz TFFF. Die Idee ist, dass reichere Industrienationen wie Deutschland und andere Investoren in diesen Fonds einzahlen. Ein Teil des Gewinns geht dann an Länder des globalen Südens, in denen Regenwälder wachsen. So werden Investitionen genutzt, um Umweltschutz zu finanzieren. Eine Win-Win-Situation?
Die Idee hat Potenzial, aber es braucht einen klaren Rahmen. Beispielsweise muss ein Teil des Geldes ohne großen Verwaltungsaufwand direkt an Indigene und lokale Gemeinden gehen. Außerdem dürfen die Investitionen, mit denen das Geld für den Tropenwaldschutz generiert wird, ausschließlich Sektoren fließen, die mit den UN Nachhaltigkeitszielen, dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Kunming-Montreal Weltnaturschutzabkommen vereinbar sind. Würde beispielsweise in große Fleisch- oder Sojaproduzenten investiert, um anschließend mit den Gewinnen den Tropenwald zu schützen, wäre dies absurd. Zudem muss klar sein, dass der Gewinn auch wirklich dem Regenwaldschutz dient. Und ein zuverlässiges Monitoring-System muss prüfen, dass die Goldminen nicht weiterhin an anderer Stelle aufploppen und somit unterm Strich nichts für den Waldschutz gewonnen ist, während die entsprechenden Länder für diesen aber Geld erhalten.
Good Gold-News aus Brasilien
Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat kürzlich eine Gesetzeslücke geschlossen, die es Käufer:innen bisher erlaubt hatte, Gold zu erwerben, ohne die Herkunft nachweisen zu müssen. Diese Lücke hatte es dem illegalen Goldabbau – oft auf indigenem Land – ermöglicht, sich unkontrolliert auszubreiten.
Künftig müssen Goldkaufende belegen, dass ihr Gold aus legalen Quellen stammt. Gleichzeitig ist die Regierung nun verpflichtet, strengere Kontrollen durchzuführen. Greenpeace begrüßt das Urteil, betont aber, dass noch mehr getan werden muss, um die betroffenen Regionen dauerhaft zu schützen. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt gegen illegalen Bergbau. Um langfristigen Schutz zu gewährleisten, sind aber weitere Maßnahmen möglich.
Die Gold-Lieferkette ist eine gemeinsame Verantwortung. Forderungen:
Was sollte die Schweiz tun?
- Die Schweizer Regierung muss sicherstellen, dass Handelsinformationen zu ihren Goldimporten mit Blick auf die gesamte Lieferkette gesammelt und öffentlich gemacht werden (also nicht nur zu den Re-Exportländern, sondern auch zu den Abbauländern und allen anderen Ländern, durch die das Gold transportiert wird). Zudem sollten die Namen der Lieferanten und Empfängerunternehmen veröffentlicht werden.
- Die aktuelle Revision des Edelmetallkontrollgesetzes muss die OECD-Richtlinien zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten und Bergbaubedingungen berücksichtigen und diese Anforderungen mit strengen Bedingungen und hohen Strafen umsetzen.
- Als zentraler Punkt in der Lieferkette müssen Schweizer Raffinerien und Schmelzereien Verantwortung übernehmen und vollständige Transparenz in Bezug auf die Herkunft und Verarbeitung von Gold bieten.
Was sollte die Bundesregierung tun?
- Unternehmen und Finanzinstitutionen entlang der Gold-Lieferkette dazu verpflichten, die Namen ihrer Lieferanten offenzulegen, einschließlich des Abbauorts und des Ortes der (wesentlichen) Verarbeitung;
- Kein Gold aus Ländern und Lieferketten importieren, die durch konfliktbelastete und hochriskante Gebiete führen;
- Unabhängige Prüfstellen einrichten, die die Einhaltung verantwortungsvoller Produktions- und Lieferkettenpraktiken überwachen.
Die Europäische Union muss:
- Umweltgefahren in die Überarbeitung der Sorgfaltspflichtverordnung im Rahmen der Konfliktmineralienverordnung aufnehmen;
- Die Schweiz auf die CAHRA-Liste (Konfliktbelastete und Hochrisikogebiete) setzen, um Unternehmen, die mit Schweizer Gold handeln, strengere Sorgfaltspflichten aufzuerlegen.
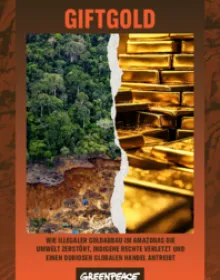
Giftgold-Report
Dateigröße: 1.4 MB
Herunterladen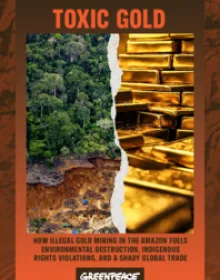
Report Toxic Gold
Dateigröße: 10.58 MB
Herunterladen














