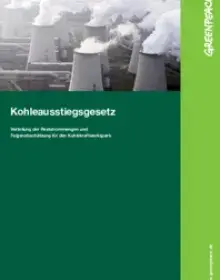Mit Emissionshandel den CO2-Ausstoß senken
- Hintergrund
Die Idee dahinter ist folgende: Die Politik legt eine Obergrenze für CO2-Emissionen für eine bestimmte Periode fest. Daraufhin bekommen alle Unternehmen, die CO2 ausstoßen, bestimmte Emissionsrechte zugeteilt oder müssen diese ersteigern. Verbessern sie ihre Technologie und verringern somit ihren CO2-Ausstoß, so benötigen sie auch weniger Zertifikate und können die überschüssigen verkaufen. Teuer wird es für CO2-intensive Unternehmen, bei denen die CO2-Emissionen steigen. Sie müssen Zertifikate zukaufen. Der Emissionshandel stellt somit ein Anreizsystem dar, CO2-Emissionen zu reduzieren, indem CO2 einen Preis bekommt. Die Kosten der Zertifikate regelt dabei der Markt. Sie sind also abhängig von Angebot und Nachfrage. Die langfristige Verringerung der Gesamtemissionen wird erreicht, indem die Anzahl der Zertifikate für die folgenden Perioden insgesamt verringert wird.
Neben dem europäischen Emissionshandel gibt es auch noch das Emissionshandelssystem zwischen Staaten, das im Kyoto-Protokoll verankert ist. Auf Basis des Kyoto-Protokolls können sich Unternehmen Reduktionszertifikate anrechnen lassen, indem sie zum Beispiel in Klimaschutzprojekte in anderen Ländern investieren. Dafür bekommen sie dann CO2-Gutschriften. Diese Instrumente laufen unter den Namen „Joint Implementation“ und „Clean Development Mechanism“.
Energielobby zieht Klimaschutzinstrument die Zähne
In der ersten Handelsperiode zwischen 2005 und 2007 hat die deutsche Emissionshandelsstelle die CO2-Emissionen ausgewählter energieintensiver Unternehmen erfasst. Je nachdem, wie hoch der CO2-Ausstoß war, haben die Unternehmen entsprechend viele Zertifikate kostenlos zugeteilt bekommen. Da die Vergabe der Zertifikate den einzelnen Mitgliedsstaaten obliegt, kam es zu einer sehr großzügigen Verteilung zugunsten der einheimischen Industrie, nicht aber der Umwelt. Zum einen wurden zu viele Emissionsrechte verteilt, zum anderen haben Kohlekraftwerksbetreiber sogar noch Gewinne eingestrichen, denn die kostenlose Zuteilung der Zertifikate kommt einer Subvention gleich.
Die Unternehmen sollten nur übergangsweise die Emissionsrechte kostenfrei erhalten. Langfristig sollen diese nur noch über die Börse versteigert werden. In der zweiten Handelsperiode zwischen 2008 und 2012 kam es bereits zur teilweisen Versteigerung. Doch diese Periode fiel zusammen mit der Wirtschaftskrise. Die Folge: Zu viele Zertifikate überschwemmten den Markt, denn viele Unternehmen drosselten ihre Produktion und reduzierten somit automatische ihren CO2-Ausstoß. Mit weniger Emissionen sank auch der Wert der Zertifikate. Ursprünglich rechnete man mit Zertifikatspreisen von etwa 30 Euro pro Tonne CO2. Inzwischen liegt der Preis bei unter fünf Euro. Der Emissionshandel kommt damit zum Erliegen. Die EU diskutiert nun darüber, die Zertifikate vorübergehend zu verknappen.
In der dritten Handelsperiode (2013 bis 2020), die nun begonnen hat, sollten alle Zertifikate über die Strombörse in Leipzig versteigert werden – Sonderregelungen verhindern diese Umsetzung allerdings. Die Gewinne sollten in den Energie- und Klimafonds fließen. Doch bei Preisen zwischen drei und fünf Euro pro Tonne CO2 kommt es weder zum Handel noch zu einer Lenkungswirkung. Die Bilanz sieht schlecht aus: Seit der Einführung des Emissionshandels 2005 bis heute ist von dem zentralen europäischen Instrument für den Klimaschutz keinerlei Wirkung ausgegangen! Die mächtige fossile Energielobby hat hinter den Kulissen dem Instrument die Zähne gezogen, mit der Konsequenz, dass sich selbst die Verstromung der besonders treibhausgasintensiven Braunkohle in Deutschland noch lohnt.
Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern: Ein leeres Versprechen
Die Gelder aus dem Energie- und Klimafonds sollten ursprünglich erneuerbare Energien fördern, die stark in der Kritik stehende CO2-Verpressung voranbringen, in Anpassungsmaßnahmen für den Klimaschutz fließen und vor allem Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern finanzieren. Da der Fonds nun weitgehend leer geblieben ist, können diese Ziele nicht umgesetzt werden. Die Industrieländer müssen den Entwicklungsländern ihre Unterstützung verwehren, obwohl sie ihnen diese auf der internationalen Klimakonferenz zugesichert haben.
Auch auf internationaler Ebene versagt
Der „Clean Development Mechanism“ (CDM) sollte Unternehmen dazu bringen, in klimafreundliche Technologien in Entwicklungsländern zu investieren. An sich eine gute Idee, deren Umsetzung jedoch fatale Folgen hat, denn Sachverständige / Behörden genehmigten sehr viele fragwürdige Projekte. So ist es zum Beispiel möglich, sich den Bau von Kohlekraftwerken in Indien und China anrechnen zu lassen, nur weil diese geringfügig effizienter sind als die alten. Solche den Unternehmen offen stehenden Handlungsoptionen hintertreiben das Kyoto-Protokoll.
Auf die richtige Umsetzung kommt es an
Der Emissionshandel wird so lange nicht funktionieren, wie die Politik nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt und sich gegen die „CO2-Mafia“ (fossile Lobby der Energiekonzerne) durchsetzt. Dabei gilt es, starke Ziele zu setzen. CO2 muss einen Preis bekommen. Für Europa bedeutet dies, das ambitionierte Einsparungsziel von 30 statt 20 Prozent bis 2020 umzusetzen. Zudem müssen überschüssige Zertifikate vom Markt genommen werden. Nur so steigt ihr Preis und nur so kann eine Lenkungswirkung einsetzen.
Statt sich beim zentralen Politikfeld des Klimaschutzes auf nur ein einziges Instrument zu verlassen, sollte die Politik auf verschiedene Maßnahmen setzen. Das Kohleausstiegsgesetz beispielsweise könnte den Klimaschutz deutlich voranbringen.